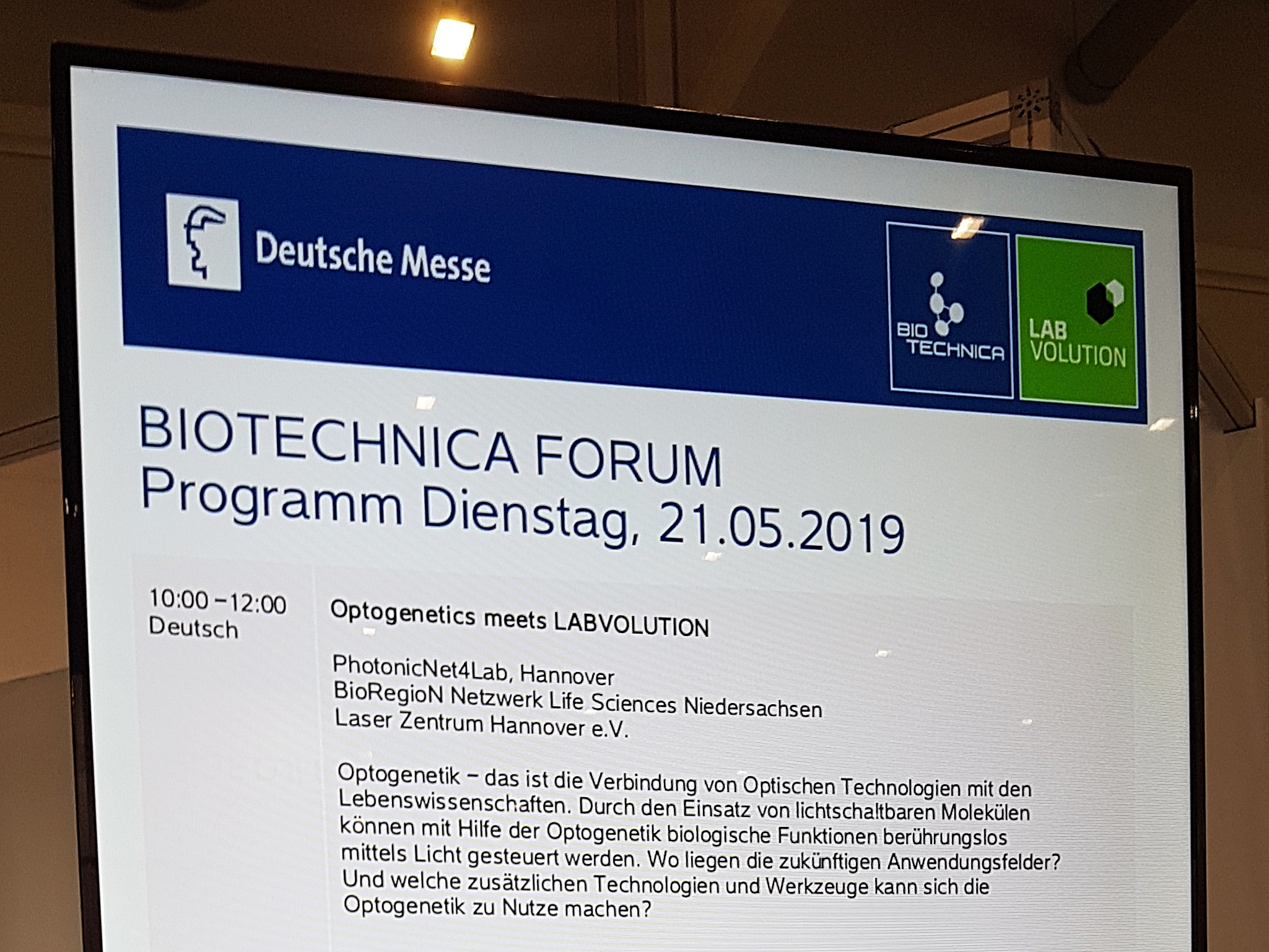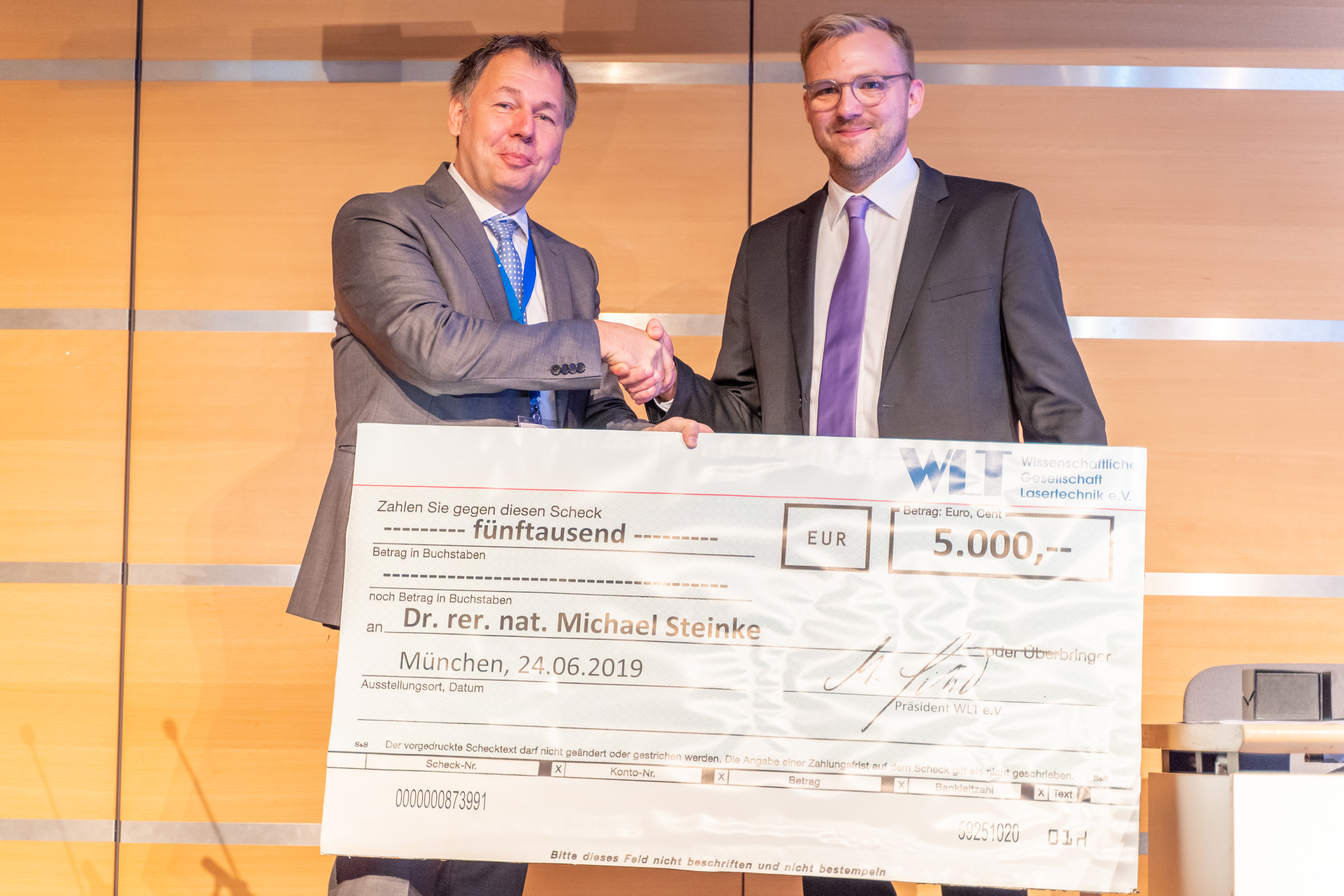Der Mond – Erdtrabant, erster Wegposten auf dem Weg zu anderen Planeten, für die Weltraumforschung von enormer Bedeutung: Mit dem ehrgeizigen Projekt MOONRISE haben sich das Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) und das Institut für Raumfahrtsysteme (IRAS) der Technischen Universität Braunschweig das Ziel gesetzt, mit einem Laser Mondstaub zu schmelzen, um ihn als Baumaterial nutzbar zu machen.
Internationale Raumfahrtorganisationen und Firmen planen nicht nur die weitere Erkundung, sondern auch die Besiedlung des Weltraums. Der Mond ist dabei als Forschungsstation und Ausgangsbasis für weitere Expeditionen von großer Bedeutung. Doch die Kosten für Flüge und Transporte zum Mond sind enorm – ein Kilogramm Nutzlast kostet gut 700.000 Euro. Daher müssten Infrastruktur, Bauteile und Geräte etc. bestenfalls direkt auf dem Erdtrabanten hergestellt werden.
Hier setzt die MOONRISE-Technologie an: „Wir wollen ein Lasersystem auf den Mond bringen, das dort Mondstaub, das sogenannte Regolith, aufschmelzen soll. Damit würden wir den ersten Schritt gehen, um die Additive Fertigung, also den 3D-Druck, auf den Mond zu bringen.“, erklärt Niklas Gerdes vom LZH. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von IRAS und LZH wollen so den Nachweis erbringen: Ein Lasersystem, das nicht mehr als drei Kilogramm wiegt und das Volumen einer großen Saftpackung hat, kann lokal auf dem Mond vorhandene Rohstoffe zielgerichtet aufschmelzen und später in vielseitige Strukturen umwandeln.
Die Möglichkeit, mit der ersten Mondmission des Berliner New-Space Unternehmens PTScientists ihre MOONRISE-Technologie im Jahr 2021 auf den Mond zu fliegen, bietet den niedersächsischen Forscherinnen und Forschern die einmalige Gelegenheit des Tests ihrer zukunftsweisenden Technologie unter realen Bedingungen.
Vision: Komplette Infrastruktur aus Mondstaub
Konkret wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Braunschweig und Hannover Regolith auf der Mondoberfläche kontrolliert - mithilfe ihres Lasersystems - aufschmelzen. Nach dem Abkühlen liegt ein fester Körper vor, der beispielsweise geeignet wäre, als Baumaterial für das „Moon Village“, die Vision des globalen Dorfes auf dem Mond als Außenposten im All, zu dienen.
Das gezielte Aufschmelzen in vordefinierte Strukturen wird mit hochauflösenden Kameras überwacht und dokumentiert. Die Erkenntnisse aus den Versuchen werden grundlegenden Einfluss auf explorative Missionen generell haben. Denn gelingt das Experiment auf dem Mond, ließe sich das MOONRISE-Verfahren auf die Erzeugung größerer Strukturen hochskalieren. Somit könnten auf lange Sicht ganze Infrastrukturen wie Fundamente, Wege und Landeflächen durch die MOONRISE-Fertigungstechnologie erbaut werden.
Entwicklung des Lasersystems in entscheidender Phase
Das Projekt MOONRISE läuft seit knapp neun Monaten. Die Ergebnisse der bisherigen Tests sind vielversprechend: Der Laboraufbau ist angepasst, geeignete, gängige Laserhardware identifiziert und getestet, die Optiken ausgelegt und erprobt. Das Material, das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Tests produzieren und verwenden, wird dem Regolith auf dem Mond immer ähnlicher. Aktuell arbeiten sie daran, den Laser an den Laderaum des Mondfahrzeuges, den sogenannten Rover, anzupassen. Der Laser wird in einen Tunnel an der Unterseite des Rovers integriert. Nach den Anpassungen wird das gesamte System auf seine Weltraumtauglichkeit getestet: denn auf dem Weg zum Mond muss das Lasersystem Erschütterungen und massiven Temperaturunterschieden widerstehen.
Stefan Linke vom IRAS erläutert: „Der von uns geplante direkte Nachweis, dass die Verarbeitung des Mond-Regoliths mit bereits verfügbaren Hardwarekomponenten möglich ist, wird entscheidend für die Planung zukünftiger Missionen sein. Größere und nachhaltige Projekte auf der Oberfläche unseres kosmischen Nachbarn werden so ermöglicht.“
Zukunftsträchtige Forschungsprojekte
treiben den Geist der Wissenschaftler
2021 soll es so weit sein: Der MOONRISE-Laser von LZH und IRAS wird ein Teil der Mondmission der PTScientists sein und integriert in den Rover mit einer Rakete auf den Erdtrabanten geschickt. Gefördert wird das ehrgeizige und zukunftsweisende Forschungsprojekt von der VolkswagenStiftung im Rahmen von „Offen – für Außergewöhnliches“. Darin unterstützt die Stiftung außergewöhnliche und gewagte Vorhaben, für die sich kein anderer Geldgeber finden lässt.
„Die Zeit ist sehr knapp, um den Prozess sicher zu machen, den dazu passenden Laser aufzubauen, zu testen und dabei das Gewichtsbudget einzuhalten,“ sagt Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer vom LZH. „Doch nur wer Unmögliches versucht, hat die Chance es zu erreichen.“
„An dem zugrundeliegendem Verfahren für die MOONRISE-Technologie arbeiten IRAS und LZH bereits seit 2015 gemeinsam. Jetzt haben wir durch das Projekt die Chance, das erste Mal in der Geschichte Additive Fertigung außerhalb der Erde und des Erdorbits zu zeigen“, erläutert Prof. Dr.-Ing. Enrico Stoll vom IRAS.
„Grundlegend neue Erkenntnisse lassen sich oft nur gewinnen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ihre Förderer bereit sind, Risiken einzugehen“, sagt Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, und ergänzt: „Auch, wenn der Ausgang der Experimente noch unklar ist, möchte die Stiftung gewagten Forschungsideen wie dieser entschlossen den Weg bereiten.“
Solide Forschung
mit dem Potenzial zum Außergewöhnlichen
Unabhängig vom Erreichen des Mondmission-Ziels wird im Rahmen des Projekts die wissenschaftlich-technische Grundlage für den 3D-Druck auf dem Mond geschaffen. „Mit dem gerade eröffneten Forschungszentrum HITec (Hannover Institute of Technology) und dem „Einstein-Elevator“ haben wir die nötige Infrastruktur in der Metropolregion Hannover-Braunschweig für zukünftige Raumfahrt-Spitzenforschung zur direkten Verfügung“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer. „Mit dem Einstein-Elevator ist es möglich, die Umgebungs- und Gravitationsbedingungen des Mondes darzustellen. Versuche in diesem Forschungsgroßgerät, unter Bedingungen wie auf dem Mond, bilden daher eine stabile Grundlage für das außergewöhnliche Vorhaben.“
Zu der Pressemitteilung gibt es zwei Bilder.